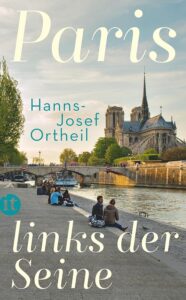In diesem Jahr feiert die literarische Welt den 650. Todestag des großen italienischen Schriftstellers und Dichters Giovanni Boccaccio (geb. 1313). In seinem Prosa-Hauptwerk, dem Il Decamerone, hat er das Erzählen auf den Gassen und Plätzen seines Heimatlandes in Novellen und Geschichten gegossen, die vom Leben seiner Mitmenschen auf unnachahmlich temperamentvolle und plastische Weise erzählen.
Wurde dieses große, weltenumspannde Werk bisher in gebührender Weise gelesen und gefeiert, so wussten die wenigsten Leserinnen und Leser, dass Boccaccio auch Gedichte geschrieben hat. Dass sie nun zum ersten Mal in einer deutschen Übersetzung („Auf einer Wiese, rings um eine Quelle“, Dieterisch´sche Verlagsbuchhandlung Mainz 2025) in einem zudem noch sehr schön ausgestatteten Band (italienisch-deutsch) vorliegen, kann man fast nicht glauben.
Ausgewählt und übersetzt hat sie Christoph Ferber, die Anmerkungen und das Nachwort hat die Romanistin Franziska Meier geschrieben. Und genau bei diesen Texten im Anhang (S. 123-196) bin ich während meiner Lektüren immer wieder hängengeblieben, auf kuriose Weise.
Denn vor allem über diese Anmerkungen tauchte ich immer tiefer in Boccaccios Lyrik ein und sammelte zunächst wie nebenbei Kenntnisse, die sie noch stärker leuchten lassen. Wusste ich vorher, dass leggiadro „einer der Schlüsselbegriffe der höfischen Liebesdichtung, der auf ein Ideal von Leichtigkeit und Eleganz anspielt und Attribut edler Frauen und Männer ist“? Boccaccio habe versucht, einen „heiteren und leichten Umgangston“ zu treffen, heißt es weiter.
Schon tat sich etwas in meinem Kopf: Hatte ich das nicht ebenso in meinem Roman Schwebebahnen“ versucht (schon der Titel weist ja darauf hin)?
In einem der Sonette (Mai non potei, per mirar molto fiso/ i rossi labri e gli occhi vaghi e belli …nell` intelletto comprender preciso …Wie sehr ich auch nur schaute, nie gelang´s mir,/die roten Lippen und die schönen Augen … im Geiste zu erfassen …) beschreibe Boccaccio, erläutert Franziska Meier, „die Schönheit der Angebeteten aus dem Blick des Liebenden“.
Und: Ich wette, kein Interpret meines neuen Romans wird je darauf kommen, dass Josefs erste Begegnung mit seiner späteren Freundin Mücke (von Fenster zu Fenster eines gegenüberliegenden Wohnhauses, S. 19-21) eine solche Szene nachstellt: der erste Blick, der eine Flamme entzündet, die Angst, das Zurückschrecken – die ganze Fülle der frühsten Erregungen ist da, bis hin zur Farbe des Kleides, der Haare und der Schleife!
So entdeckte ich in den Boccaccio-Lektüren etwas Eigentümliches, über die Jahrhunderte hinweg.